Tausendgüldenkraut
Als Verwandter des Enzians ist das Tausendgüldenkraut, ebenso wie dieses, eine starke Bitterpflanze.
Daher fördert es auch die Verdauungstätigkeit und regt die Bildung der Verdauungssäfte an.
Seine verdauungsfördernde Wirkung und die damit verbundene Stärkung ist so ausgeprägt, dass das Tausendgüldenkraut zu den ganz besonders wertgeschätzten Heilpflanzen gehört. Das wird auch schon an seinem Namen mehr als deutlich.
Das Tausendgüldenkraut ist schon seit dem Altertum eine sehr wichtige Heilpflanze, doch ist sie inzwischen so selten geworden, dass sie streng unter Naturschutz steht.
Steckbrief
| Haupt-Anwendungen: | Magenschmerzen, |
|---|---|
| Heilwirkung: | anregend, beruhigend, blutreinigend, entzündungshemmend, Gebärmutter stärkend, Immunsystem stärkend, stärkend, tonisierend, |
| Anwendungsbereiche: | Abszesse Abwehrschwäche Anämie Appetitlosigkeit Aufstoßen Blutarmut Blähungen Chronische Magenentzündung Darmkatarrh Diabetes Dyspepsie Ekzeme Erschöpfung Fieber Frühjahreskurs Förderung des Magensaftes Gallenschwäche Gallensteine Gallestauung Gastritis Gelbsucht Gelenkrheumatismus Gicht Koliken Kreislaufschwäche Leberstauung Magenentzündung Magenkatarrh Malaria Menstruationsbeschwerden Meteorismus Milzschwellung Müdigkeit Nervenschwäche Obstipation Rekonvaleszenz Rheuma Ringelflechte Schlecht heilende Wunden Schwäche Skrofulose Sodbrennen Verdauungsstörungen Verdauungsschwäche Verstopfung Wunden Übergewicht |
| wissenschaftlicher Name: | Centaurium umbellatum, Centaurium Minus Moench, Gentiana centaurium, Erythraea centaurium |
| Pflanzenfamilie: | Enziangewächse = Gentianaceae |
| englischer Name: | Centaury |
| volkstümliche Namen: | Aderntee, Agrinken, Allerweltsheil, Apothekerblum, Aurin, echtes Tausendguldenkraut, Erdgalle, Fieberkraut, Gallkraut, rotes Garbenkraut, Gartenheide, Gottesgnadenkraut, Geschosskraut, Himmelblümlen, Hundertgüldenkraut, Kleines Tausendgüldenkraut, Laurin, roter Laurin, Magreiten, Muttergotteskraut, Potrak, Rother Aurin, Strand-Tausendgüldenkraut, Santor, Schmeckeblume, Sinögge, Sintau, Tausendkraft, Tollhundskraut, Tsantali, Unserer Lieben Frau Bettlstroh, Unserer Lieben Frau Wegstroh, Verschreikräutel |
| Verwendete Pflanzenteile: | das ganze blühende Kraut ohne Wurzel |
| Inhaltsstoffe: | Bitterstoffglykoside, Erytaurin, Erythrocentaurin, Erythramin, Gentianin, Harz, ätherisches Öl, Zucker, Magnesiumlactat, Fettsäuren |
| Sammelzeit: | Juli und August |
Anwendung
Das Haupteinsatzgebiet des Tausendgüldenkrauts ist die Verdauungsschwäche, vor allem die des Magens.
Magenschmerzen und chronische Magenschleimhautentzündung sind prädestiniert für die Behandlung mit Tausendgüldenkraut.
Durch seine Bitterstoffe stärkt das Tausendgüldenkraut die Verdauung so nachhaltig, dass es die tausend Gulden, die in seinem Namen stecken, mehr als wert ist.
Zur Bitterkeit des Tausendgüldenkrautes sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es wirklich sehr bitter ist. Seine Verwandtschaft zum Enzian kommt hier voll zum Tragen.
Obwohl das Tausendgüldenkraut bei schwächlichen, appetitlosen Menschen den Appetit fördert, hilft es bei übergewichtigen Menschen auch gegen ihr Übergewicht. Das mag in beiden Fällen an der Stärkung der Verdauungsvorgänge liegen.
Zusammen mit Wermut kann Tausendgüldenkraut im Tee die Bauspeicheldrüse stärken, sodass es gegen leichte Formen von Diabetes helfen kann.
Achtung!
Tausendgüldenkraut sollte nicht bei Magengeschwüren und Zwölffingerdarmgeschwüren angewendet werden.
Tee als Kaltauszug
Den Tee bereitet man als Kaltauszug, dazu lässt man 1/2 bis 1 TL Tausendgüldenkraut auf 1 Tasse Wasser sechs bis acht Stunden ziehen.
Dann seiht man den Tee ab und erwärmt ihn vorsichtig auf Trinktemperatur.
Vom Tausendgüldenkraut-Tee trinkt man täglich vor den Mahlzeiten zwei Tassen in kleinen Schlucken.
In Mischtees kann man das Tausendgüldenkraut auch als normalen Aufguss zubereiten, aber dann ist die Wirkung weniger effektiv.
Teemischung zur Verdauungsstärkung
Tausendgüldenkraut eignet sich sehr gut in Mischtees.
In solchen Teemischungen wirkt die Bitterkeit des Tausendgüldenkrautes weniger intensiv.
Hier ein Beispiel für eine magenstärkende Teemischung:
Mische zu gleichen Teilen (gewichtsmäßig):
- Tausendgüldenkraut
- Kalmuswurzel
- Enzianwurzel
- Kamille
- Fenchel

Tausendgüldenkraut-Tinktur
Alternativ kann man Tausendgüldenkraut auch als Tinktur anwenden, dann nimmt man 10 bis 20 Tropfen in etwas Wasser vor den Mahlzeiten ein.
Für die Tinktur befüllt man ein Schraubdeckeglas mit frischen oder getrockneten Kräuterstücken.
Darüber gießt man Doppelkorn oder 70%igen Alkohol aus der Apotheke, bis die Kräuterteile vollständig bedeckt sind.
Diesen Ansatz lässt man zwei bis sechs Wochen ziehen, dann seiht man die Flüssigkeit ab und füllt sie in eine dunkle Flasche.
Kühl aufbewahrt, hält sich solch eine Tinktur mindestens ein Jahr.
Häufig ist das Tausendgüldenkraut auch Bestandteil von Magenbitter.
Äußerliche Anwendung
Äußerlich wird das Tausendgüldenkraut seltener eingesetzt.
Die Volksheilkunde kennt jedoch einige äußerliche Anwendungen des Tausendgüldenkrautes.
Man kann seinen Tee als Waschung, Bad oder für Umschläge verwenden.
Seine Einsatzgebiete sind vor allem eiternde Wunden, Ekzeme und Flechten.
Geschichtliches

Schon im Altertum war das Tausendgüldenkraut eine beliebte Heilpflanze.
Der Name „Centaurium“ kommt möglicherweise ursprünglich nicht von dem hundertfachen Gold, das man zunächst vermutet, sondern von einem Zentaur names Chiron. Dieser heilte nach der Legende seine vereiternden Wunden mit dem Tausendgüldenkraut. Diese Namensherkunft ist jedoch umstritten.
Die berühmten Ärzte des Altertums wie Hippokrates schätzten das Tausendgüldenkraut sehr.
Im Mittelalter wurde die Wortbedeutung des Hundertguldenkrautes dann vor lauter Begeisterung gesteigert und es entstand das Tausendgüldenkraut, mancherorts sogar das Milijöntusenkraut.
Das Tausendgüldenkraut spielt auch in vielen Geschichten und Legenden eine wichtige Rolle. Dort soll es Gesundheit und großen Reichtum bringen.
Eine dieser Legenden erklärt auch den Namen des Tausendgüldenkrautes auf eine neue Weise. In dieser Geschichte geht es um einen reichen Mann, der unter Fieber litt. Er bot armen Leuten tausend Gulden an, wenn sie ihn von dem Fieber befreien würden. Die Armen gaben dem kranken Reichen das Tausendgüldenkraut und erhielten nach erfolgter Heilung wie versprochen tausend Gulden.
Außerdem erhoffte man sich den Schutz vor Blitzschlag durch das Tausendgüldenkraut.
Hildegard von Bingen empfiehlt Tee aus dem Tausendgüldenkraut zur Heilungsförderung bei Knochenbruch.
Leonhart Fuchs schreibt in seinem 1543 veröffentlichten Kräuterbuch über das Tausendgüldenkraut:
„Dieweil der Tausendgulden sehr bitter ist, kann man leichtlich abnehmen, das es on alle scherpffe austrücknet und wermet. Zeeicht auch ein wenig zusammen, darum es ein Wundkraut ist.“
Pflanzenbeschreibung
Das Tausendgüldenkraut wächst vor allem auf Waldwiesen, Lichtungen, aber auch auf Halbtrockenrasen. Dort bevorzugt es kalkreichen, warmen Boden mit hohem Lehmanteil.
Allerdings ist das Tausendgüldenkraut nicht sehr wählerisch mit dem Boden, manchmal findet man es sogar auf moorigem Boden.
Dennoch kommt das Tausendgüldenkraut fast nirgendwo häufig vor.
Das Tausendgüldenkraut gehört zur Familie der Enziangewächse, was man ihm nicht unbedingt auf den ersten Blick ansieht. Sein bitterer Geschmack passt aber sehr gut zur Enzianfamilie.
Es ist eine ein- bis zweijährige Pflanze, die 20 bis 40 cm hoch wird.
Das Tausendgüldenkraut hat einen vierkantigen Stängel, der sich ab einer gewissen Höhe spärlich verzweigt. Die Wuchsform erinnert ein wenig an das Johanniskraut, mit dem es jedoch nicht verwandt ist.
Es hat gegenständig sitzende Blätter, die länglich und eiförmig sind und über fünf parallel verlaufende Nerven verfügt.
Die rosafarbenen Blüten blühen von Juni bis August.
Sie stehen in einer Trugdolde. Die Einzelblüten sind trichterförmig.
Jede Blüte hat fünf Blütenblätter.
Eine Besonderheit ist, dass sich die Blüten erst öffnen, wenn es mindestens 20 Grad warm ist.
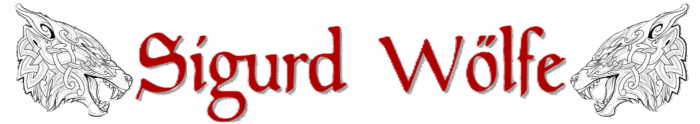

Comments on 'Tausendgüldenkraut' (0)
Kommentar-Feed